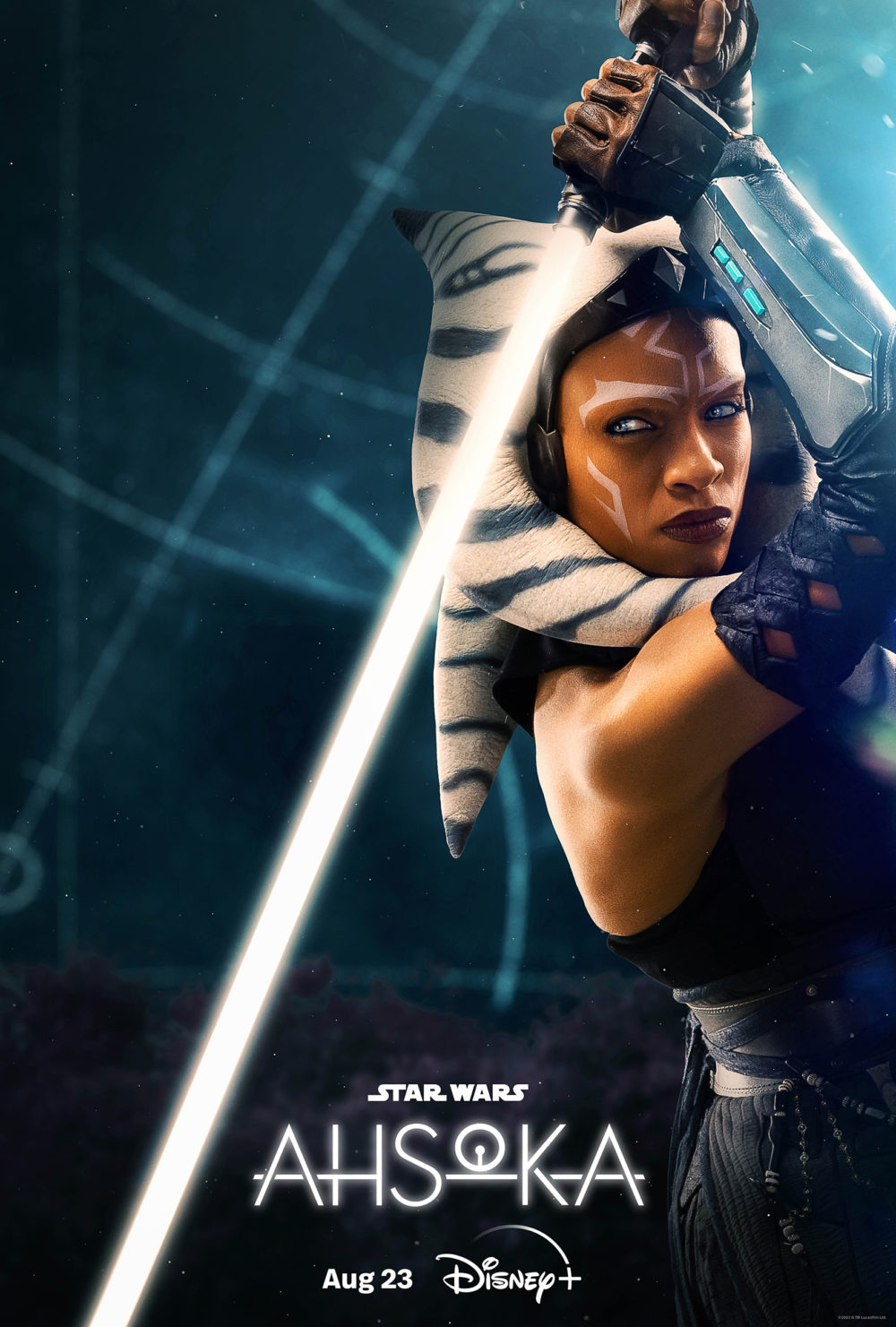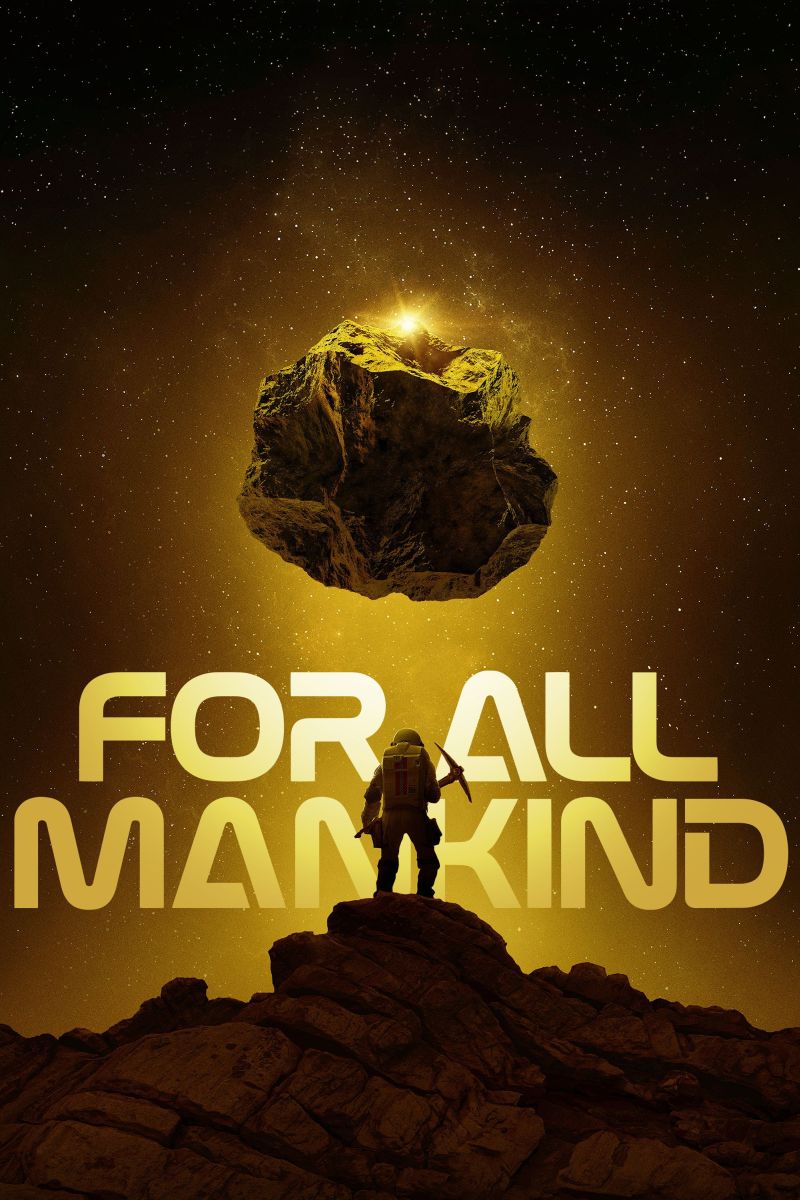Es gibt Franchise-Ikonen, die weniger durch Dialoge als durch Silhouetten, Geräusche und Rituale Eindruck hinterlassen. Bei Predator reichen drei rote Punkte, ein schepperndes Klickgeräusch und das Surren der Tarnung aus, um die Mythologie zum Leben zu erwecken.
Seit John McTiernans Urknall von 1987 hat die Reihe in Urban-Thrillern, Kriegsallegorien, Crossover-Experimenten und Prequel-Neuerfindungen an Profil gewonnen, an Strahlkraft verloren und sie wiederentdeckt. Mit Dan Trachtenbergs Predator: Badlands steht nun ein Kapitel an, das den Kanon erneut verschieben will. Zeit für eine Bestandsaufnahme. Analytisch, filmhistorisch, ohne Fanboy-Nostalgie-Brille.
Die Geburt eines Kino-Mythos: Predator (1987)
John McTiernans Original ist auf dem Papier ein High-Concept: Ein außerirdischer Jäger nimmt in Mittelamerikas Dschungel eine US-Elitetruppe ins Visier, doch die Form macht den Unterschied. Der Film beginnt wie ein klassisch testosterongetriebener Actionfilm der 1980er Jahre, um dann nach und nach die überlegene Technologie seiner Protagonisten, die unsichtbare Bedrohung und schließlich die Natur selbst zu offenbaren.
Stan Winstons Kreaturendesign, die zerfurchte Unterkiefermaske, der ikonische Biomasken-Helm, die Schulterkanone, die Klingen am Unterarm und Kevin Peter Halls physische Präsenz verleihen den „Yautja“ (der Name stammt aus späteren Erweiterungen des Kanons) diese aristokratische Brutalität, die den Feind zum eigentlichen Charakter erhebt. Alan Silvestris perkussive Filmmusik, die Wärmebild-Perspektive, das Tri-Laservisier: Predator ist eine Lehrstunde in Sachen audiovisueller Signaturgestaltung.
Und trotz all der Action ist es ein Film über die eigene Arroganz. Je schwerer die Waffen, desto offensichtlicher die Machtlosigkeit, bis Arnold Schwarzeneggers Dutch im Schlamm zum Jäger wird, weil er wieder lernen musste, wie ein Krieger zu denken.

Vom Dschungel in den Betondschungel: Predator 2
Stephen Hopkins verlegt das Jagdrevier in ein hitziges, modernes Los Angeles und lässt Danny Glover einen müden Polizisten spielen, der sich gegen den Ehrenkodex der Jäger stellt. Der Perspektivwechsel vom Militär zur Stadtpolizei eröffnet neue Welten, birgt jedoch die Gefahr, dass die existenzielle Klarheit des ersten Films verloren geht. Formal bleibt der charakteristische Stil erkennbar (Wärmebildkamera, Trophäenritual), thematisch kommen Territorialkämpfe und urbane Paranoia hinzu.
Die viel zitierte Trophäenwand im Schiff mitsamt dem Xenomorph-Schädel ist mehr als nur ein Easter Egg: Sie verankert Predator in dem damals aufkommenden Cross-Franchise-Denken und sagt gleichzeitig etwas über die Jagdkultur aus: Er sammelt Geschichte, um seine eigene zu schreiben. Die AVP-Filme sind vielleicht die umstrittensten Spin-offs: konzeptionell verlockend mit zwei Monstermythen auf einem Schlachtfeld, aber ästhetisch oft näher am Gaming-Underground als an der filmischen Gravitas der Originalreihe. Und dennoch erfüllen sie ihren Beitrag zum Kanon.
Sie etablieren die Idee ritualisierter Prüfungen („Young Bloods“, Ehrenkodex, Markierungen) und unterstreichen die Trophäenkultur, die in anderen Formaten wieder auftaucht. Requiem dämpft den Grundton, senkt die Altersfreigabe, verliert jedoch seinen menschlichen Fokus. Menschen werden zu Schachfiguren in einem Kulissen-Overkill. Entscheidend ist jedoch, dass der Predator kein Dämon ist sondern eine Mischung aus Tradition, Technologie und Wettbewerb.
Kurskorrektur durch Rückbesinnung: Predators (2010)
Nimród Antals Beitrag (produziert von Robert Rodriguez) wirkt wie ein Gegenpol zur Crossover-Spirale. Die Prämisse: Wir bekommen keine Besucher, sondern sind als Beute in eine fremde Jagdlandschaft versetzt worden. Adrien Brody, Alice Braga, Topher Grace und Laurence Fishburne spielen keine muskelbepackten Archetypen, sondern moralisch fragile Spezialisten (Söldner, Arzt, Kartell-Scharfschütze), die in einem „Wildreservat” gegeneinander und gegen verschiedene Jäger-Kasten antreten.
Der Film greift die Überlebensmechanismen des ersten Teils wieder auf, erweitert jedoch die Predator-Soziologie: Es gibt Clans, Hunde, Hierarchien. Dramatisch bleibt er episodisch, thematisch hingegen ist er raffiniert: Die „besten Jäger“ der Menschheit werden als Beute entlarvt und als zynischer Kontrast dargestellt. Shane Black, der im Original Hawkins spielte, versucht sich an einer Mischform: Militärsatire, Familienfilm, Splatter, Comedy-artiger Rhythmus. Die Idee der genetischen Optimierung des Predators mag im Ansatz konzeptionell funktionieren (Evolution als Waffe), filmtechnisch gesehen passt der Ton jedoch nicht.
Pulp-Humor kollidiert mit Body Horror, Charaktere werden zu Stichwortgebern und die Mythologie verliert ihre Ernsthaftigkeit. Die Idee, den Jäger nicht nur als Trophäensammler, sondern auch als eine Figur zu sehen, die vor ihrer eigenen Kultur flieht, bleibt spannend und bietet viel Potenzial, doch die inhaltliche Überfrachtung verhindert eine Katharsis.

Der Befreiungsschlag: Prey (2022)
Dan Trachtenberg bringt die Serie zurück zu einer Transparenz, die seit 1987 fehlte. 1719, Great Plains: Naru (Amber Midthunder), eine junge Comanche-Frau, die Jägerin werden möchte, trifft auf einen Predator, der ihr technologisch überlegen ist, aber kulturell denselben Herausforderungen ausgesetzt ist wie sie. Das Prequel konzentriert sich auf anthropologische Genauigkeit (Kultur der Comanchen, Jagdrituale), fesselnde Inszenierung und eine zentrale These: der Predator als Spiegel. Narus Reise ist kein „Girl Boss“-Update, sondern eine konsequente Weiterführung der eigenen DNA der Filmreihe: beobachten, lernen, Schwächen erkennen und den Feind mit seiner eigenen Logik besiegen.
Diese Logline ist explosiv. Erstens, weil der Jäger als Ausgestoßener plötzlich eine Charakterreise antritt, die über Trophäen (Ehre, Zugehörigkeit, Identität) hinausgeht. Zweitens, weil das Bündnis mit einem Menschen, das zuvor nur vorübergehend denkbar war, in der Erzählung zu einer ethischen Frage wird: Was bedeutet Jagen ohne Kodex? Und drittens, weil eine neue Umgebung die Mythologie aus dem Dunstkreis der Erde herausholt.
Wenn Prey die Ursprünge der Jagd poetisch verarbeitet hat, könnte Badlands die Ehre in der Zukunft thematisieren. Technologie, Trophäen, Code, Bausteine einer Legende. Die Wärmebildperspektive ist niemals nur eine nette Spielerei, sondern sie macht die Jagd nachvollziehbar: Bewegung, Temperatur, Muster. Tarnung ist kein Unsichtbarkeitszauber, sondern taktische Überlegenheit, vorausgesetzt, der Gegner interpretiert die Umgebung falsch.
Das Tri-Laservisier ist sowohl eine Drohgebärde als auch ein Markenzeichen, und Selbstzerstörung ist mehr als nur ein dramaturgisches Mittel: Sie schützt den Kodex. Und dieser Kodex (keine wehrlosen Gegner, Anerkennung eines gleichwertigen Feindes) ist der „humanistische Kern“ der Reihe. Prey und konzeptionell auch Badlands verstehen, dass Technologie hier nur das Mittel ist, nicht die Methode.

Ikonografie und Handwerk: Warum wir den Predator „lesen“ können
Stan Winstons Skulptur entstand in den 1980er Jahren, aber ihre Sprache ist zeitlos: Die Kiefer vermitteln den Schrecken des „Außerirdischen“, der Helm die Noblesse des Kriegers, und der Körper ist nicht nur muskulös, sondern bewegt sich auch mit der Würde eines rituellen Wesens. Die Filmmusik, von Silvestris archaischen Trommeln bis hin zu den reduzierten Klanglandschaften der heutigen Ableger, arbeitet mit dem Rhythmus, nicht mit Pathos. Das Sounddesign der Klick-Geräusche ist ein Markenzeichen und charakterisierend. Die Inszenierung, wenn sie denn funktioniert, setzt eher auf Raum und Zeit statt auf ein Schnittfeuerwerk: Die Jagd ist schließlich ein Element der Geometrie.
Predator ist kein Universum, das von der Interpretation von Legenden lebt, sondern von seiner Klarheit: ein Gegner, ein Territorium, ein Kodex und die Frage, wer hier wirklich auf der Jagd ist. Deshalb setzt die Film-Marke sowohl auf Minimalismus (Prey) als auch auf Welterweiterung (Predators). Sie scheitert, wenn Ton und Ethos auseinander laufen (The Predator), und sie gewinnt, wenn die Charaktere die Jagd-Grammatik ernst nehmen. Es kommt nicht darauf an, wie viele Gadgets die Yautja haben, sondern darauf, ob der Film versteht, was sie aussagen.
Wenn Badlands seine Prämisse einhält, könnte die Reihe die vielleicht spannendste Veränderung seit 1987 erleben: den Jäger als Suchenden. Ein verbanntes Wesen, das seinen Kodex neu lernen muss, und ein menschlicher Partner, der für moralische Reibung sorgt. Das ist nicht nur frisches World-Building, sondern auch eine Gelegenheit, die rituelle Figur endlich zu einem echten Film-Charakter zu machen. Die Jagd war nie vorbei. Sie hat nur ihr Revier gewechselt.