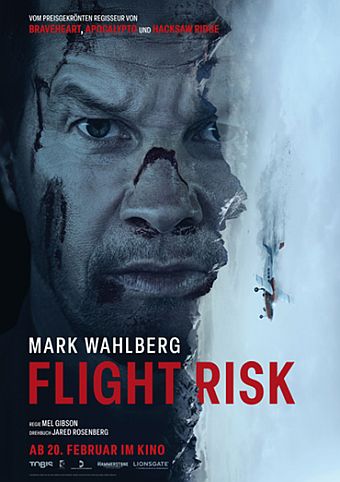Inhalt: Ein achtjähriges Kind leidet darunter, dass die Leute es hartnäckig bei seinem Geburtsnamen „Aitor“ nennen, welcher bei ihm Unbehagen auslöst. Sein Spitzname „Cocó“ fühlt sich nicht ganz so verkehrt, aber auch nicht richtig an. Im Sommerurlaub im Baskenland vertraut das Kind seinen Kummer Verwandten und Freund*innen an. Doch wie geht eine Mutter, die selbst noch mit ambivalenten elterlichen Altlasten ringt, mit der Identitätssuche ihres Kindes um?
Film Kritik:
Cocó ist acht Jahre alt und weiß jetzt schon, dass irgendetwas nicht mit ihr stimmt. Denn, das ihre Familie sie Aitor nennt gefällt ihr so gar nicht. Im Urlaub möchte sie nicht mit den anderen Kindern am Pool spielen, sondern lieber mit der Oma die Bienenstöcke besuchen.
Berlinale 2023: „Sonne und Beton“ – Film Kritik
Sie hat das Gefühl mit ihrer Oma über alles reden zu können. So fragt sie ihre Oma auch ob sie erst sterben muss, um als Mädchen auf die Welt kommen zu können. Während die Oma immer mehr begreift wer Cocó ist, hat Cocós Mutter eine ganz eigene Krise. Sie möchte sich beruflich nochmal neu orientieren. Auch die Beziehung zu dem Vater ihrer drei Kinder steht auf wackeligen Beinen.
Und genau jetzt scheint Cocó zu rebellieren. Dabei ist sie für ihre Mutter doch immer nur ein sehr sensibler Junge gewesen. Gerade erst erschien der neue sehr umstrittene Film von Florian David Fitz zu selben Thematik. Das man ein Thema aber durch die Augen eines Kindes ganz anders begreifen tut, macht „20.000 Arten von Bienen“ deutlich.

Ähnlich einer Dokumentation
Die gefeierte Jungdarstellerin Sofia Otero wurde für ihre Leistung im Rahmen der Berlinale mit dem Preis als beste Darstellerin ausgezeichnet. Nicht nur das sie als jüngste Darstellerin jemals bei der Berlinale eine Auszeichnung erhielt, ihr Debüt auf der Leinwand gleicht einer reifen schauspielerischen Performance. Ähnlich wie Helena Zengel in „Systemsprenger“, schafft es Otero eine nicht einfache Rolle mit so einer Leichtigkeit darzustellen das man glaubt eine Dokumentation zu sehen.
Berlinale 2023: Wann wird es endlich wieder so, wie es nie war – Film Kritik
Und das gerade weil jeder Gesichtsausdruck, jede Träne, jeder Gefühlsausbruch nicht gespielt wirkt, sondern aus der jungen Schauspielerin herauszubrechen scheint. Eine beeindruckende Leistung, die unterstützt wird von einer großartigen Kameraarbeit. Auch bildlich wirkt der Film so einfach, das der Eindruck erscheint eine Dokumentation zu sehen. Die Kamera bewegt sich immer in der Nähe der Charaktere, gibt ihnen aber auch genug Raum. Es erscheint, als wäre die Kamera eine beobachtende Person, die nie aufdringlich oder wegweisend eingreift. Durch die Symbiose zwischen Otero und der Kamera, wirkt das Ganze sehr natürlich.
Awarness für Themen schaffen, die in der Bevölkerung immer noch nicht voll und ganz akzeptiert werden, ist eine wichtige Aufgabe, welche Solaguren vollends meistert. Gerade die feinen Nuancen zu treffen, nicht direkt dem Zuschauer das Thema des Filmes um die Ohren zu hauen, sondern sich dem Ganzen zu nähern, wie es ein Kind machen würde, sorgt für ernsthaften Tiefgang.

Gänsehaut Momente
Wir sehen und begreifen den Umfang des Themas Schritt für Schritt. Wir nähern uns der Erkenntnis im selben Ausmaß wie Cocó es uns vormacht. Diese stellt erst ihren Namen in Frage, dann ihre Erscheinung und dann ihr Ganzes Sein. Sie weigert sich anzuerkennen, dass sie später so aussehen soll wie ihr Vater, denn das ist nicht ihr Wunsch. Sie will ein Mädchen sein und fragt sich auch was eigentlich schief gelaufen ist. Ist der Fehler im Bauch ihrer Mutter passiert, als sie plötzlich den Körper eines Jungen bekommen hat?
Berlinale 2023: „Das Lehrerzimmer“ – Film Kritik
Und gerade das Ende des Filmes schafft es in einer winzigen Sekunde so viel Emotionen zu durchlaufen, dass man Gänsehaut bekommt. Der Film wird in langsamen, sommerlichen Bildern erzählt und dürfte den ein oder anderen Zuschauer durch seine manchmal träge wirkende Erzählweise verlieren. Wer aber in diesen langsameren Bildern begreift, dass eben nicht jedes Thema sofort verarbeitet werden kann – und auch Cocó selbst noch Zeit braucht zu verstehen wer sie ist, der sieht in den warmen Sommertagen, welche nach Freiheit duften, auch die schwere der langsam kommenden Erkenntnis.
Fazit: Der Film tut einfach gut, fühlt sich richtig an und das mit so einfachen Mitteln. Er verliert sich kaum in den langsamen Bildern und wirkt vor allem durch Oteros Leistung noch lange nach. „Oskars Kleid“ dürfte etwas mehr für das Mainstream Publikum zugeschnitten gewesen sein, „20.000 Arten von Bienen“ ist dafür die ehrlichere, prägendere Erzählung. Gerade weil ein so berührendes Ende nicht viele Worte benötigt.
Film Bewertung: 9 / 10