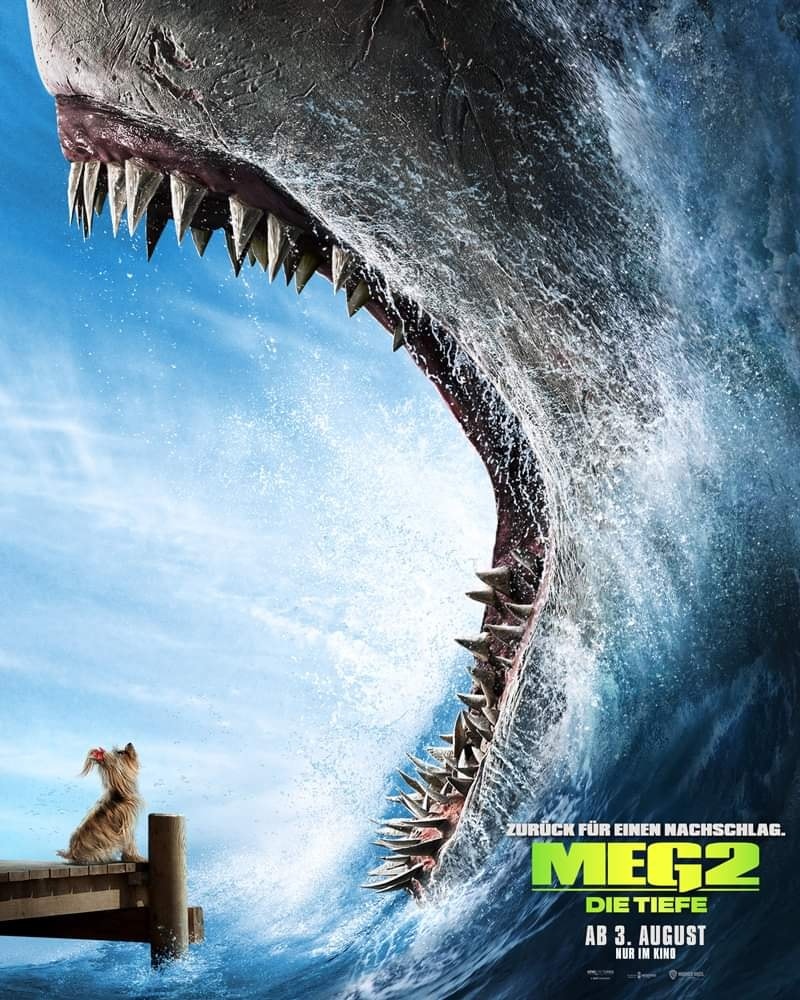Inhalt: TRON: ARES folgt einem hochentwickelten Programm namens Ares, das aus der digitalen in die reale Welt auf eine gefährliche Mission geschickt wird und die erste Begegnung der Menschheit mit KI-Wesen darstellt.
Ein Wettlauf um den Permanent-Code
Schon der erste Tron von 1982 war ein Wagnis. Regisseur Steven Lisberger schickte Programmierer in schimmernde Software-Landschaften, experimentierte mit CGI in einem Ausmaß, das bis dahin unvorstellbar war, und erschuf damit ein frühes Stück Filmgeschichte. Tron war stilistisch revolutionär, doch weder Publikum noch Kritiker waren damals restlos überzeugt. Die Vision wurde erst im Rückblick als wegweisend erkannt.
Als Joseph Kosinski 2010 mit Tron: Legacy die verspätete Fortsetzung inszenierte, war auch das ein Risiko. Er experimentierte mit De-Aging-Technologie bei Jeff Bridges, erweiterte die virtuelle Welt des „Grid“ und ließ Kevin Flynn selbst ironisch über „bio-digitalen Jazz“ sprechen. Doch auch dieser Film scheiterte an einer allzu kühlen Figurenzeichnung, fand seine Stärke vor allem in der Daft-Punk-Musik und der stilisierten Neon-Optik. Nun wagt Disney mit Tron: Ares einen dritten Anlauf – inszeniert von Joachim Rønning, einem Regisseur, der sich mit Blockbuster-Fortsetzungen wie Fluch der Karibik: Salazars Rache als solides Studio-Handwerk bewiesen hat.
Doch so bahnbrechend das Original einst war, so vorsichtig tastet sich dieser neue Teil voran: optisch ansprechend, laut, visuell opulent, aber erzählerisch dünn. Ein verpixelter Prolog holt das Publikum ab: 15 Jahre sind seit Legacy vergangen. Garrett Hedlunds Sam Flynn wird nicht zurückkehren, ebenso wenig Bruce Boxleitner. Erstmals bleibt Tron selbst außen vor. An seine Stelle entfaltet sich ein Machtkampf zwischen zwei Konzernen.
Figuren als Karikaturen
Eve Kim (Greta Lee), gefeierte Spiele-Designerin, führt heute ENCOM, jenes Unternehmen, das schon im Originalfilm eine zentrale Rolle spielte. Ihr Gegenüber ist Julian Dillinger (Evan Peters), Enkel des klassischen Schurken Ed Dillinger. Peters spielt ihn als herrlich schmierigen Tech-Bro mit Platinen-Tattoos, der sogar seine Mutter Elisabeth (Gillian Anderson mit kühler Autorität) hintergeht, um an die Spitze von Dillinger Systems zu gelangen. Beide Konzerne konkurrieren um die Entwicklung einer neuen KI, die mittels riesiger 3D-Drucker in die reale Welt transferiert werden kann. Eine beängstigend zeitgemäße Idee.
Doch dafür benötigen sie einen „Permanent-Code“, ein algorithmisches MacGuffin, das nur auf Kevin Flynns altem Server schlummert. „Wer den Code kontrolliert, kontrolliert die Zukunft“, erklärt Dillinger in einem Moment, der fast wie ein Zitat aus Dune wirkt. So entspinnt sich ein nerdiges Wettrüsten, ein „Nerd-Off“, wie der Film selbst ironisch durchscheinen lässt. Statt komplexe Fragen über Macht, Technik und Verantwortung zu stellen, rattert die Handlung jedoch mit plakativen Gefahrenlagen und Dialogzeilen wie „Bereitet den Partikellaser vor!“ voran. An Potenzial mangelt es nicht: Gerade Jared Leto als Ares hätte eine spannende Projektionsfläche sein können.
Eine KI, die sich fragt, was es bedeutet, Mensch zu sein, das schreit nach existenzieller Tiefe. Doch das Drehbuch begnügt sich damit, Ares eine merkwürdige Vorliebe für 80er-Jahre-Kitsch und Depeche Mode zuzuschreiben. Was als Charakterisierung gedacht ist, wirkt wie ein Gimmick. Jared Leto bleibt eine inhaltsleere Worthülse, die eher Parodie als Drama liefert.

Ein Fest für Augen und Ohren
Greta Lee hingegen überzeugt in ihrem Blockbuster-Debüt. Nach der subtilen Tragik in Past Lives spielt sie hier eine nahbare, geerdete Protagonistin. Ihr erstauntes „Oh mein Gott“, als sie zum ersten Mal das Grid betritt, transportiert genau jene Mischung aus Faszination und Ungläubigkeit, die das Publikum spüren soll. Jodie Turner-Smith bringt als Programm Athena eine kühle Unmenschlichkeit ins Spiel – ihr starrer Blick und die rauchigen Augen verleihen ihr eine Aura bedrohlicher Fremdheit, die eindrucksvoll in Erinnerung bleibt.
Inhaltlich bleibt der Film flach, optisch dagegen wird er seinem Erbe gerecht. Leuchtspuren, Light-Cycles, neu erfundene Gadgets wie ein Wingsuit, ein Panzer, ein U-Boot oder Lichtschwerter. Tron: Ares präsentiert seine Technik wie ein Kind, das mit den Schlüsseln klimpert. Regisseur Rønning inszeniert das Ganze als aufwendiges, hochglanzpoliertes Spektakel. Aber die eigentliche Sensation ist der Soundtrack. Nine Inch Nails dominieren den Film, wobei Trent Reznor und Atticus Ross Musik komponieren, die mal brutal industriell, mal verspielt nach Techno klingt. Tech-Noir im Gewand eines Berliner Nachtclubs.
Ein Film-Score, der den Film selbst übertrifft, wie es hier der Fall ist, gibt es selten. Wie bei Daft Punk in Legacy trägt die Filmmusik den Film und verleiht ihm eine Gravitas und Energie, die die Bilder allein nicht erreichen könnten. Man möchte das Album öfter hören als den Film sehen.
Tron als kulturelles Erbe
Trotz aller Kritik darf man nicht vergessen, welche Bedeutung Tron für die Filmkultur hat. Der erste Film von 1982 war seiner Zeit weit voraus – als einer der ersten, der CGI in großem Umfang nutzte. Damals wurde das visuelle Experiment belächelt, heute gilt es als Meilenstein. Tron hat die Ästhetik späterer Science-Fiction-Filme beeinflusst und ganze Generationen von Game-Designern, Grafikern und digitalen Künstlern inspiriert. Die neonleuchtenden Rasterflächen, die Light-Cycles und die Idee eines „Grids“ als eigene Welt schufen eine Bildsprache, die bis heute in Videospielen, Werbekampagnen und Pop-Designen nachhallt.
Auch die Verbindung von Musik und Visualität war prägend: Wendy Carlos’ elektronischer Score im Original, Daft Punks orchestraler Elektro-Mix in Legacy, nun Nine Inch Nails mit Industrial-Power – jeder Tron-Film hat seine Zeit auch musikalisch definiert. Gleichzeitig steht die Reihe sinnbildlich für den Zwiespalt von Innovation und Mainstream. Sie war immer visuell an vorderster Front, aber erzählerisch selten in der Lage, diese Visionen in gleicher Tiefe zu spiegeln. So bleibt Tron bis heute ein kulturelles Phänomen: stilbildend, wegweisend, aber auch widersprüchlich.
Tron: Ares hat etwa so viel Tiefgang wie eine Diskette, sieht aber dafür umwerfend aus und klingt auch besser. Greta Lee überzeugt als neue Heldin, Evan Peters hat Spaß mit dem Bösewicht-Klischee, aber die eigentlichen Stars sind die CGI-Effekte und der Soundtrack.
Fazit: Das reicht für zwei Stunden bombastisches Kino an einem Freitagabend. Aber nicht für eine ernsthafte Rückkehr einer legendären Science-Fiction-Reihe. Und doch bleibt die Filmreihe in einer Hinsicht unersetzlich: Sie erinnert uns daran, dass Film manchmal auch ein Experimentierfeld ist, ein Raum, in dem Technologie, Musik und Visionen ein Eigenleben entwickeln dürfen. Mit anderen Worten: digitaler Jazz, auch wenn er nicht immer harmonisch klingt.
Film Bewertung 5 / 10