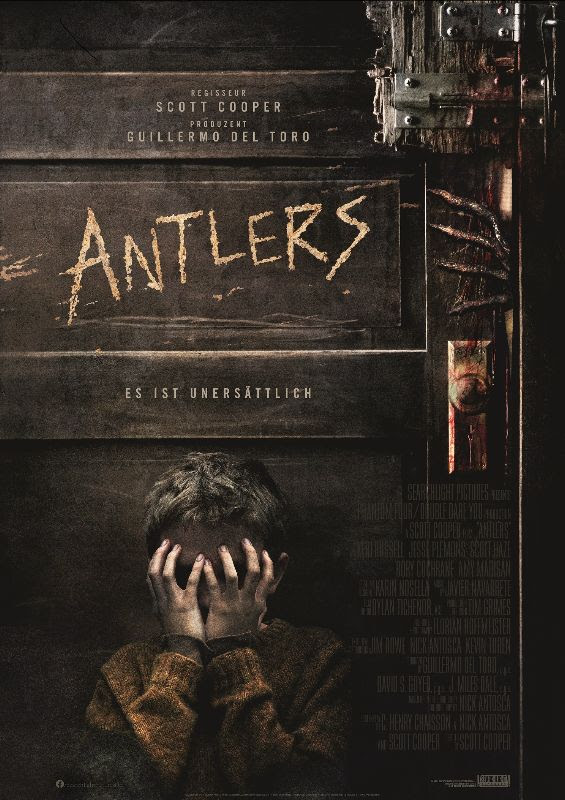Inhalt: Ein Jahr nach dem mysteriösen Verschwinden ihrer Schwester Melanie begeben sich Clover und ihre Freunde auf der Suche nach Antworten in das abgelegene Tal, in dem sie verschwunden ist. Bei der Erkundung eines verlassenen Besucherzentrums werden sie von einem maskierten Killer verfolgt und einer nach dem anderen auf grausame Weise ermordet…
Ungefähr 15 Minuten nach Beginn von Until Dawn warnt ein unheimlicher Tankstellenangestellter eine Gruppe Teenager, dass „weiter unten auf den Straßen viele verschwinden“. Die Gruppe ist auf dem Weg zu einer abgelegenen Waldhütte – und das „Cabin-in-the-Woods“-Gefühl setzt sofort ein. Ein vertrauter Aufbau, klar, aber man hofft, dass der kommende Horror wenigstens einfallsreich sein könnte – vielleicht sogar mit einem Augenzwinkern. Diese Hoffnung verfliegt jedoch schneller, als einem lieb ist.
Denn obwohl der Film auf dem gleichnamigen PlayStation-Horrorspiel basiert, erinnert er inhaltlich kaum an die Vorlage – und das ergibt sogar Sinn. Das Spiel selbst ist ein recht klassischer Slasher: Teenager verbringen ein Wochenende in der Wildnis, und die Gefahr ist vorprogrammiert. Der eigentliche Reiz liegt in der Entscheidungsfreiheit – man beeinflusst als Spieler, wer überlebt. Genau dieses Element fällt im Film weg. Stattdessen gibt es eine neue Mechanik: Um der zeitschleifenartigen Hölle zu entkommen, müssen die Figuren bis zum Sonnenaufgang überleben.
Ein gutes Konzept – jede Nacht neue Bedrohungen, neue Monster, neue Möglichkeiten. Doch Until Dawn nutzt dieses kreative Potenzial nicht. Stattdessen reiht der Film altbekannte Horrorkonzepte aneinander: ein maskierter Mörder, eine Hexe, Wendigos (wie aus dem Spiel) – alles da, alles belanglos. Die Szenen wirken austauschbar, die Monster erschreckend generisch. Der Film spielt all die bekannten Horror-Hits runter, ohne je einen eigenen Ton zu finden. Und schlimmer: Er nimmt sich viel zu ernst, um wirklich Spaß an seiner Prämisse zu haben.

Was als kreativer Albtraum beginnt, endet als Aufguss altbekannter Horrorformeln – trotz starker Prämisse und solider Inszenierung
Ein paar Szenen blitzen auf: eine explosive Badezimmerszene, die mit visueller Kreativität überrascht; eine Found-Footage-Montage, die stilistisch Abwechslung verspricht. Doch immer dann, wenn Until Dawn beginnt, interessant zu werden, zieht er sich ängstlich zurück – zurück ins Gewöhnliche, zurück ins Gesehene. Regisseur David F. Sandberg (Lights Out) liefert zwar handwerklich solide Spannungsmomente, aber das Drehbuch gibt ihm wenig Raum, wirklich Neues zu erzählen. Die Figuren bleiben flach, mit Ausnahme von Ji-Young Yoo, die als Hellseherin Megan sichtbares Engagement zeigt.
Peter Stormare kehrt als Dr. Alan J. Hill zurück – eine bekannte Figur aus dem Spiel – doch sein Auftritt ist zu kurz, seine Rolle letztlich wirkungslos. Erzählerisch krankt der Film an schlampiger Struktur. Wichtige Handlungsstränge verlaufen im Sand: Megans übersinnliche Kräfte spielen keine echte Rolle, Clovers emotionale Verbindung zu ihrer Schwester ist spätestens zur Halbzeit vergessen. Die Hintergrundgeschichte des Grauens bleibt diffus, und der obligatorische Monolog im letzten Akt stiftet eher Verwirrung als Aufklärung. Die Erzählung wirkt unausgegoren – als wollte der Film jederzeit in den nächsten Gang schalten, aber sich nie ganz traut.
Fazit: Until Dawn will seinen eigenen Weg gehen, losgelöst von seinem Ausgangsmaterial. Ironischerweise endet der Versuch, anders zu sein, damit, dass es sich klischeehafter denn je anfühlt. Was als innovativer Genrebeitrag starten könnte, verheddert sich in Altbekanntem – und lässt einen enttäuscht im Dunkeln zurück.
Film Bewertung 4 / 10