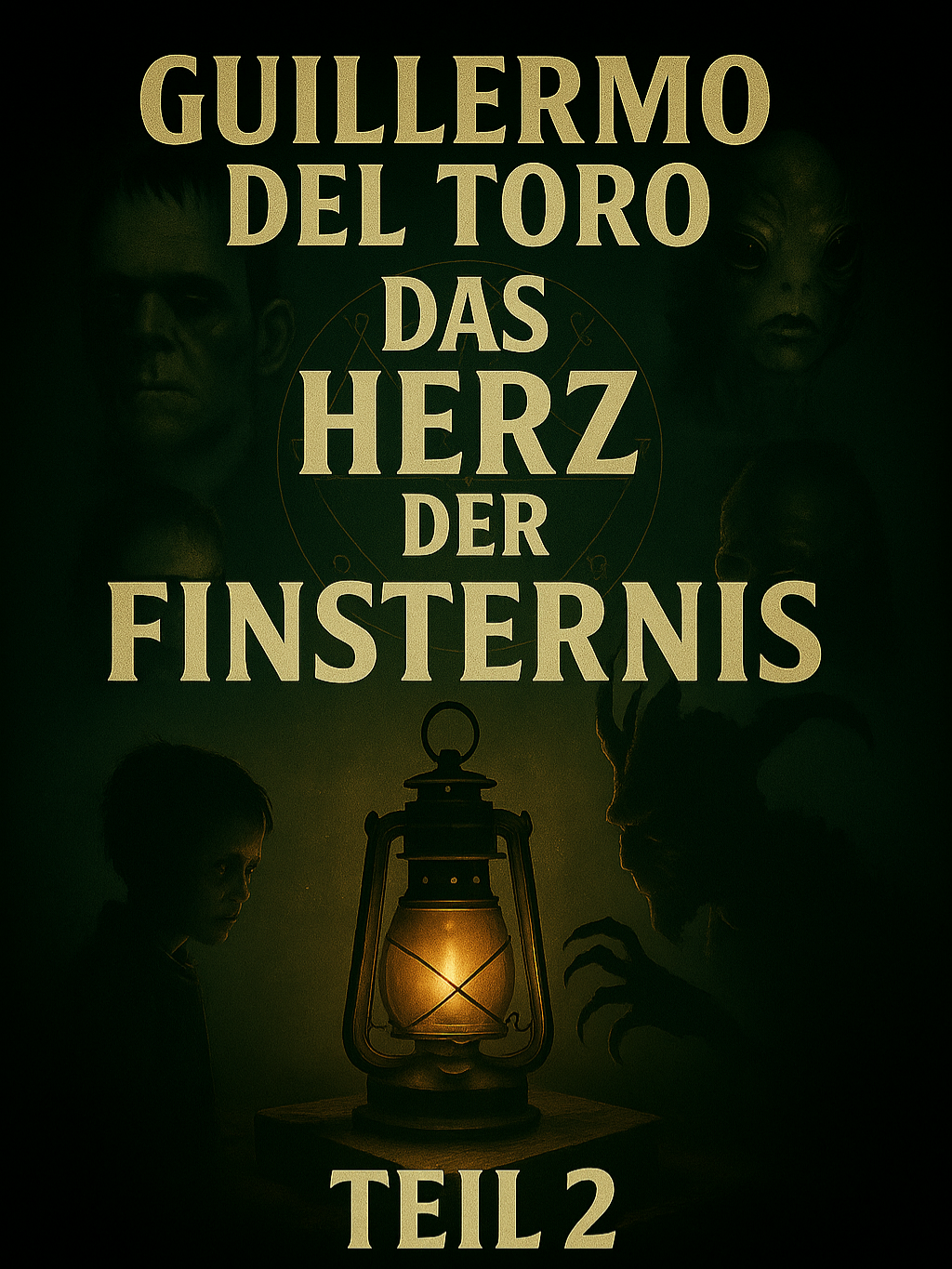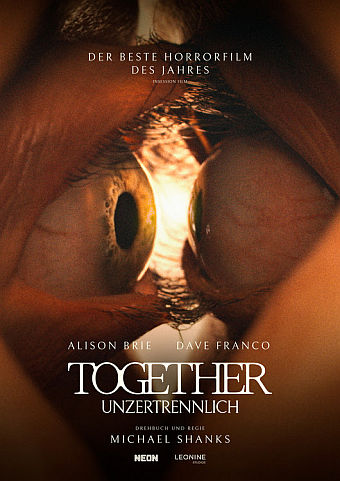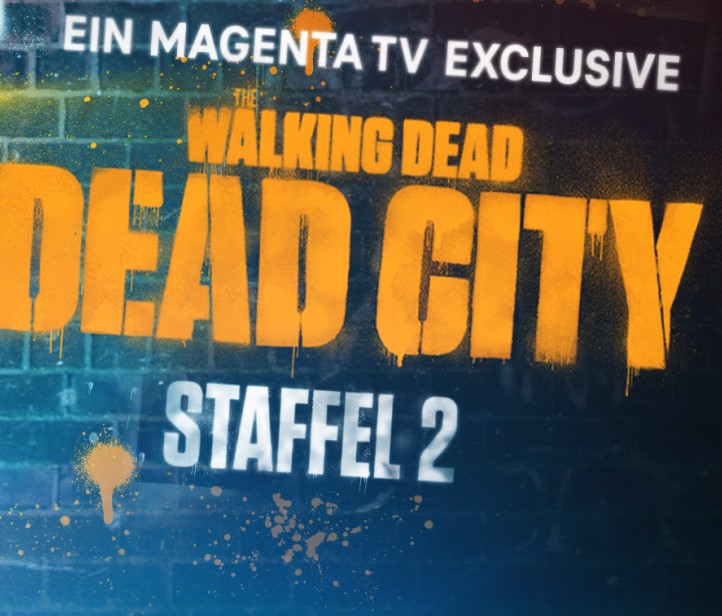Nach der kreativen Niederlage mit Mimic suchte Guillermo del Toro nicht nach einer Vergeltung, sondern nach Sinn. In Interviews beschreibt er diese Zeit als „Rückzug in die Dunkelheit, um das Licht wiederzufinden“. Er kehrt zu seinen Wurzeln zurück, nach Europa, zu den Überresten seiner Geschichte.
Diese Rückkehr ist nicht nur geografischer Natur, sondern auch spiritueller Art. Del Toro war nie ein politischer Filmemacher im klassischen Sinne; seine Haltung ist die eines Humanisten, der das Politische durch das Private offenbart. In Spanien entdeckt er ein Terrain, das wie geschaffen für seine Themen erscheint: eine Nation gezeichnet vom Bürgerkrieg, beladen mit Schuld und Schweigen.
Aus dieser Landschaft entstehen zwei seiner größten Werke: The Devils Backbone (2001) und Pan`s Labyrinth (2006).
„Ich wollte wieder spüren, was Film für mich bedeutet. Nicht mit Maschinen, sondern durch Menschen, die sich erinnern.“
Guillermo del Toro im Gespräch mit Sight & Sound
The Devil’s Backbone – Das Rückgrat des Schmerzes
Der erste Film dieser sogenannten „spanischen Phase“ ist eine melancholische Geistergeschichte. Sie spielt 1939, gegen Ende des Bürgerkriegs, in einem abgelegenen Waisenhaus, das von Explosionen erschüttert und von Geheimnissen durchdrungen ist. Eine nicht explodierte Bombe liegt mitten im Hof und symbolisiert, was del Toro zeigen möchte: Krieg als eine noch nicht aufgelöste Erinnerung. Der Junge Carlos begegnet dem Geist eines ermordeten Kindes. Doch del Toro verweigert sich dem klassischen Horror. „Ich wollte, dass der Geist nicht erschreckt, sondern anklagt“, erklärte er. „Er ist die Stimme derer, die keine haben.“
Damit formuliert er seine eigene Ethik des Fantastischen: Das Übernatürliche ist keine Flucht, sondern eine Form der Gerechtigkeit. Visuell ist The Devil’s Backbone ein Übergangswerk. Guillermo Navarro taucht das Waisenhaus in ein Spektrum aus Rostrot, Gold und Staub; jede Einstellung wirkt wie von Licht gezeichnetem Bernstein überzogen. Die Geister erscheinen nicht als transparente Phantome, sondern als verletztes Fleisch, als Erinnerung, die in der Materie klebt. Del Toro nennt das „moralischen Realismus“.
Er will, dass der Schrecken fühlbar bleibt, physisch, menschlich. Thematisch kehrt hier alles wieder, was Cronos vorbereitete: der Konflikt zwischen Unschuld und Verderben, zwischen Erlösung und Schuld. Das Waisenhaus ist eine Miniatur-Gesellschaft, in der Macht, Angst und Begierde in ständiger Wechselwirkung zueinander stehen. Für del Toro ist es auch ein Spiegelbild Mexikos. Ein Land, das, wie er sagt, „immer noch von den Geistern seiner Kolonialgeschichte heimgesucht wird“.
Trotz seiner düsteren Grundstimmung endet der Film mit einem Akt der Sanftheit. Die Kinder tragen den Körper ihres Freundes hinaus ins Licht, während hinter ihnen das Waisenhaus in Flammen steht. „Ein Bild der Befreiung“, nennt es del Toro. „Aber Befreiung ist nie schmerzlos.“

Das Märchen als Überlebensstrategie
Fünf Jahre später, 2006, verwandelt Guillermo del Toro dieselben Themen in ein Werk von epischer Schönheit. Pan’s Labyrinth ist kein Sequel, sondern eine spirituelle Fortsetzung. Wieder Spanien, wieder die Nachwehen des Krieges, diesmal 1944. Ein Mädchen, Ofelia (Ivana Baquero), zieht mit ihrer schwangeren Mutter in die Garnison ihres neuen Stiefvaters, Hauptmann Vidal, einem faschistischen Offizier, gespielt von Sergi López. In der Nacht entdeckt sie eine geheimnisvolle Kreatur, den Faun (Doug Jones), der sie in ein Reich jenseits der Realität führt.
Das zentrale Motiv bleibt: die kindliche Vorstellungskraft als Zufluchtsort. Aber anders als in typischen Fantasy-Erzählungen ist Ofelias Welt kein harmloser Traum. Sie ist von Regeln, Prüfungen und moralischen Entscheidungen durchzogen. Jede Fantasie ist hier auch ein Widerstand gegen die gelebte Realität. Del Toro formuliert es so: „Das Märchen ist nicht der Eskapismus. Es ist der einzige Weg, die Wahrheit zu überleben.“ Ofelias drei Aufgaben sind zugleich moralische Prüfungen: Gehorsam vs. Gewissen, Angst vs. Mut, Opfer vs. Liebe. Sie spiegeln die grausame Welt außerhalb des Labyrinths, in der Vidal Folter als Ordnung betrachtet und Unterwerfung als Tugend.
Der eigentliche Horror ist nicht das Monster mit Augen in den Händen, der legendäre Pale Man, sondern der Mensch, der keine Augen im Herzen hat.Pans Labyrinth balanciert gekonnt zwischen Brutalität und Poesie. Navarros Kamera bewegt sich zwischen weichen, fast malerischen Lichtstimmungen und abrupten Schattenbrüchen. Die Farbdramaturgie, Blau-, Braun- und Goldtöne, spiegelt den Übergang zwischen Realität und Fantasie. Javier Navarretes Filmmusik, eine simple Wiegenmelodie, wird zum Leitmotiv des gesamten Films, Trost und Trauer in einem Atemzug.
Erinnerung als Moral
Die Weltpremiere in Cannes endet mit stehenden Ovationen. Sechs Oscar-Nominierungen, drei Auszeichnungen (Kamera, Make-up, Produktionsdesign). Aber del Toro selbst misst den Erfolg anders: „Der Film hat mich mit dem Kind in mir versöhnt“, sagt er im BAFTA-Interview (2007). „Und mit dem Monster, das ich geworden bin.“ In beiden Filmen geht es um dasselbe Fundament: Erinnerung als moralische Pflicht.
Del Toro, der als Kind die Schrecken der mexikanischen Drogengewalt kannte, glaubt an das Kino als Akt des Gedenkens. „Geschichten sind Friedhöfe, in denen wir unsere Toten ehren“, schrieb er in seine Notizensammlung (Cabinet of Curiosities, 2013). Diese Idee macht seine spanische Phase zu einer Filmethik. Für ihn sind Geister niemals nur Schreckensfiguren, sondern Verkörperungen des Unbewältigten. In The Devil’s Backbone fragt er: Was passiert mit der Geschichte, wenn sie niemand mehr erzählt?
In Pan’s Labyrinth lautet die Antwort: Sie verwandelt sich in Mythos. Das Märchen ist das Gefäß, in dem Erinnerung überlebt. Dabei arbeitet del Toro mit archetypischen Strukturen. Der Faun ist eine ambivalente Vaterfigur – teils Retter, teils Verführer. Ofelias Mutter steht für die Anpassung an patriarchale Gewalt; der Widerstand der Partisanen für das Gewissen, das weiterlebt. Jede Figur ist Symbol und Mensch zugleich. Gerade diese Dualität verleiht seinen Filmen emotionale Tiefe.
„Del Toro hat das Genre des Fantasy-Films vom Eskapismus befreit und es in eine Liturgie des Mitgefühls verwandelt.“
Kritiker Mark Kermode – The Observer (2006)
In der Tat ist Pan’s Labyrinth nicht nur ein Märchen über Kinder, sondern eine Parabel über den moralischen Akt des Widersprechens. Ofelias Weigerung, unschuldiges Blut zu vergießen, ist die reinste Form des Widerstands.
Das Kind im Spiegel
Guillermo del Toro sieht in seinen Kinderfiguren keine Unschuld, sondern Erkenntnis. Die Kinder in seinen Filmen sind nicht das Symbol für Hoffnung, sondern für Wahrheit. Sie sehen, was Erwachsene verleugnen. Carlos und Ofelia sind zwei Seiten derselben Medaille: das Auge, das nicht blinzelt, sobald es das Grauen erkennt.
Psychologisch lässt sich diese Konstellation auch autobiografisch lesen. Del Toros Kindheit war geprägt von Gewalt, nicht körperlich, sondern emotional. Sein Vater wurde 1997 entführt, kurz nach den Dreharbeiten zu Mimic. Die Familie zahlte Lösegeld, doch der Schock blieb. „Ich lernte, dass das Böse real ist“, sagte er im Gespräch mit The New Yorker (2017). „Und dass Fantasie die einzige Möglichkeit ist, ihm zu begegnen.“ In Pan’s Labyrinth fließt dieses Trauma in die Figur des Vidals: die autoritäre Vaterfigur, die Ordnung erzwingt, indem sie Empathie vernichtet. Er konstruiert ihn nicht als Karikatur des Faschismus, sondern als Archetyp toxischer männlicher Machtgelüste.
Vidal repräsentiert all das, was der Regisseur ablehnt: Kontrolle, Gehorsam, moralische Skrupellosigkeit. Der Film wird so zu einer Antithese seines eigenen Hollywood-Erlebnisses: Vidal = Weinstein. Ofelia = Guillermo. Das Märchen als Gegenzauber.

Die Poesie des Grauens
Formal betrachtet, bildet Pan’s Labyrinth den Höhepunkt von del Toros handwerklicher Philosophie. Nichts im Film ist digital; alle Kreaturen sind Masken, Prothesen, mechanische Skulpturen. Doug Jones, sein langjähriger Kreaturen Darsteller, beschreibt die Arbeit in Fangoria (2007): „Guillermo verlangt, dass du die Figur fühlst, bevor du sie spielst. Er will, dass du an sie glaubst.“ So entsteht ein Kino, das nicht auf Simulation, sondern auf Verkörperung setzt. Diese Hingabe zum Materiellen hat einen ethischen Kern. Für del Toro ist das handgefertigte Bild Ausdruck von Verantwortung. „Wenn du ein Monster kreierst“, sagt er, „musst du es lieben, sonst wird es dir Lügen erzählen.“
Er spricht hier nicht nur über Latex, sondern über Menschlichkeit. Das physische Handwerk wird zur moralischen Geste gegen die Entfremdung der modernen Blockbuster-Ästhetik. Auch die Musik folgt diesem Prinzip. Navarretes Melodie wird in der finalen Szene nicht als Trauer, sondern als Erlösung interpretiert. Die Kamera sinkt nach unten, das Licht wird wohlig-warm. „Sie hat das Reich betreten, das sie sich erschaffen hat“, kommentiert del Toro im Audiokommentar (Warner Home Video, 2007). „Und vielleicht sind wir alle dazu bestimmt, in unsere Geschichten einzutauchen.“
Nach dem internationalen Triumph von Pan’s Labyrinth wird Guillermo del Toro in einem Atemzug mit Jean Cocteau, Terry Gilliam und Tim Burton genannt: Poeten des Fantastischen. Doch seine Stimme bleibt einzigartig, weil sie den Horror nicht ästhetisiert, sondern humanisiert. Er selbst sagt bei seiner Oscar-Rede 2018: „In meinen Filmen geht es nicht um Monster. Es geht um Menschen, die Monster lieben.“ Diese Haltung macht ihn zu einem moralischen Gegenpol im zeitgenössischen Kino.
Der Humanist des Horrors und Dichter der Erinnerung
Während viele Genre-Filme Gewalt als Spektakel zeigen, verwendet del Toro sie als Ausdruck von Verlust. Sein Blut hat Gewicht. Seine Wunden haben Geschichte. Und jedes Monster trägt den Abdruck einer menschlichen Seele. Mit The Devil’s Backbone und Pan’s Labyrinth findet Guillermo del Toro seine wahre Stimme. Er verwandelt Horror in eine elegische Geschichte, das Märchen in eine ethische Erzählung, die Fantasie wird zur Erinnerung.
Beide Filme sind Meditationen darüber, was bleibt, wenn die Lichter ausgehen: Mitgefühl. In dieser spanischen Phase verschmilzt er zum ersten Mal Form, Thema und Emotion zu einem Ganzen. Es ist die Geburtsstunde des „del-Toro-Realismus“, einer Ästhetik, die das Übernatürliche als natürliche Erweiterung des Menschlichen begreift. Er erzählt von Monstern, damit wir lernen, uns selbst zu vergeben. Im Kino gibt es viele Regisseure, die das Böse darstellen. Guillermo del Toro ist einer der wenigen Filmemacher, die das Gute sichtbar machen, indem sie es in der Finsternis aufspüren.
Und so gibt es am Ende von Pans Labyrinth weder Tod noch Verlust, sondern einen stillen Triumph inmitten all der Grausamkeit: Ein Kind stirbt, um die Menschheit zu retten. Das ist wahrscheinlich sowohl das Wunderbarste als auch das Schrecklichste, was das Kino bewirken kann.
JETZT LESEN: DAS HERZ DER FINSTERNIS TEIL 1
Morgen in Teil 3: Zwischen Stahl und Seele – Die Maschinen des Mitleids