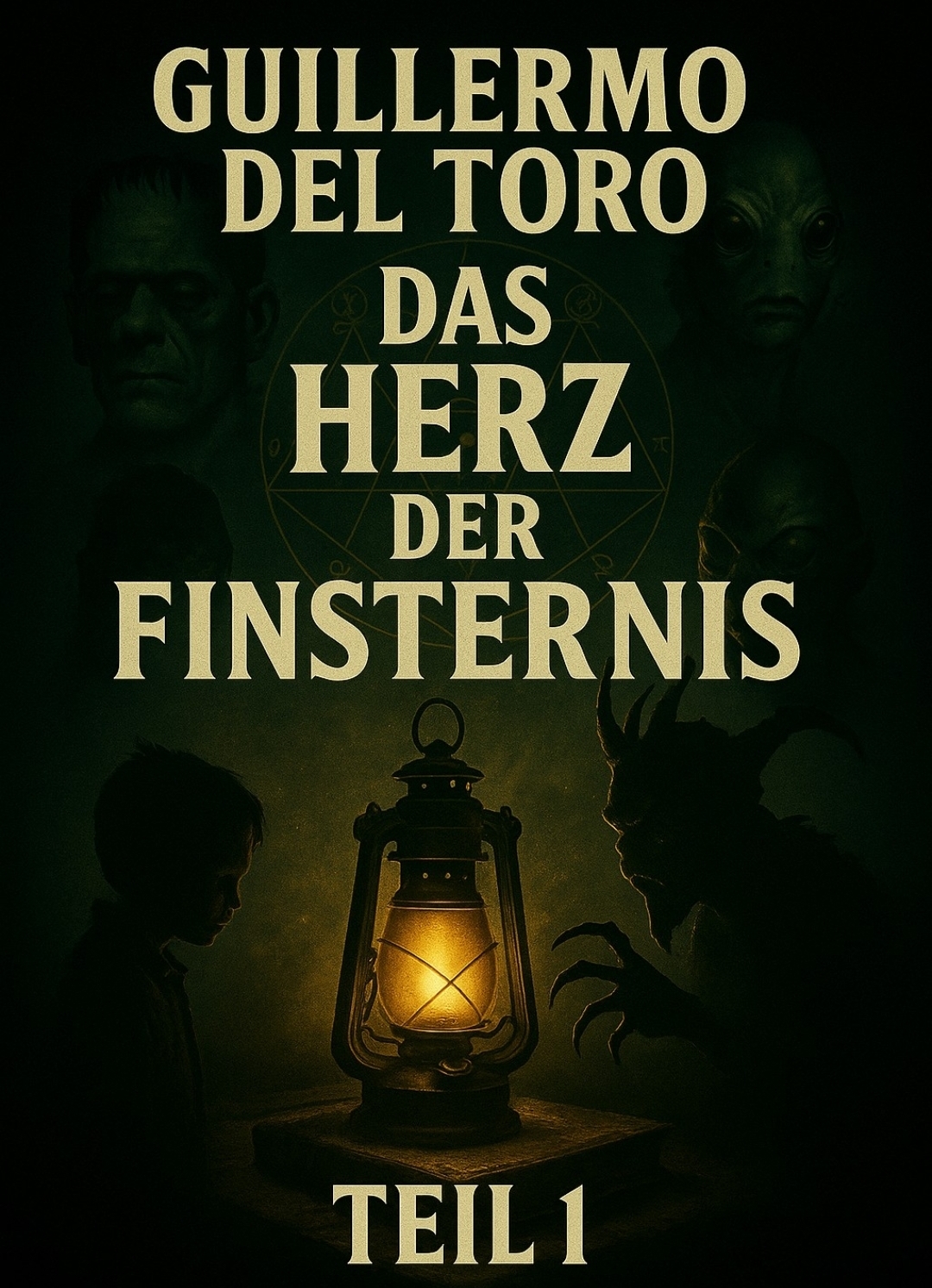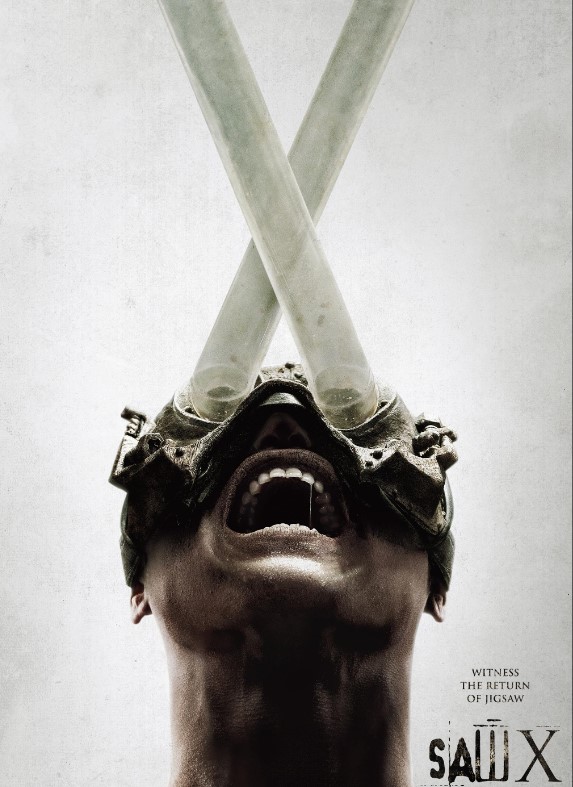Guillermo del Toro erinnert sich immer wieder an den Moment, der sein Leben veränderte. Es war 1971, Guadalajara, Mexiko. Der siebenjährige Sohn eines Autohändlers saß gebannt im Kino, als Boris Karloff in James Whales Frankenstein (1931) über die Leinwand wankte.
„Ich hatte Mitleid mit dem Monster, nicht mit den Menschen“, erzählte er in einem Gespräch mit dem New York Times Magazine. „Ich wusste damals: Ich will die Welt aus seiner Perspektive sehen.“ Dieses frühe Mitgefühl für das Ausgestoßene zieht sich wie ein Blutstrom durch seine gesamte Karriere. Del Toro wächst in einem streng katholischen Elternhaus auf, durchdrungen von Heiligenbildern, Reliquien, Märtyrerlegenden.
In seinem 2013 veröffentlichten Skizzenband Cabinet of Curiosities beschreibt er, wie ihn die religiöse Bildsprache prägte: „Ich fand Trost in der Vorstellung, dass Schönheit aus Schmerz geboren wird.“ Diese Ambivalenz zwischen Glauben und Zweifel, zwischen Liebe und Grauen, sollte später das Fundament seines filmischen Kosmos bilden.
Der Junge, der das Monster verstand
Als Jugendlicher dreht er mit der Super-8-Kamera Kurzfilme, baut Monster aus Wachs und Gips, studiert in Guadalajara Spezialeffekte bei Dick Smith, dem legendären Maskenbildner von The Exorcist (1973). Schon hier zeigt sich sein Verständnis von Kino als Handwerk. „Ich glaube nicht an Magie, ich glaube an Mechanik“, sagte er der Criterion Collection . „Jede Emotion im Film muss gebaut, geschnitzt, modelliert werden.“
1992 verwirklicht del Toro seinen ersten Langfilm. Cronos entsteht mit geringem Budget, doch mit einer Fülle an Ideen, die das spätere Werk bereits vorwegnehmen. Ein alter Antiquitätenhändler (Federico Luppi) entdeckt ein goldenes, insektenartiges Uhrwerk, das ewiges Leben schenkt, aber Blutgier entfesselt. Die Geschichte verbindet katholische Symbolik: Unsterblichkeit als Versuchung, mit Körperhorror und moralischer Tragödie. Del Toro entwirft das Design des titelgebenden Artefakts selbst. Das Gerät, halb Skarabäus, halb mechanisches Herz, steht exemplarisch für seinen Stil: das Technische wird zum Organischen, das Heilige zum Profanen.
Kameramann Guillermo Navarro taucht den Film in bernsteinfarbenes Licht, das zwischen Wärme und Verfall changiert, ein visuelles Markenzeichen, das del Toro später in Pan’s Labyrinth (2006) oder The Shape of Water (2017) weiterentwickeln wird. „Ich wollte, dass man den Geruch des Metalls spürt“, erklärte del Toro, „Jede Oberfläche sollte atmen.“ Diese Materialisierung der Sinnlichkeit, diese Mischung aus Abscheu und Zärtlichkeit, ist das, was sein Kino von Anfang an geprägt hat.

Mimic – Die Hölle der Kontrolle
Der Erfolg auf Festivals unter anderem gewann Cronos die Critics’ Week in Cannes, verschafft dem jungen Mexikaner internationale Aufmerksamkeit. Aber der Preis ist hoch: Hollywood klopft an. Und Hollywood dreht bekanntlich seine Kinder oftmals durch den Fleischwolf. Fünf Jahre später landet del Toro in den Studios von Miramax. Mimic (1997) sollte sein Eintritt in den Mainstream werden. Ein düsterer Sci-Fi-Thriller über genetisch manipulierte Insekten, die sich gegen ihre Schöpfer wenden.
Doch die Dreharbeiten geraten zum Albtraum. Produzent Harvey Weinstein greift massiv in den Schnitt ein, fordert Nachdrehs, streicht Sequenzen. „Ich fühlte mich, als würde man mir bei lebendigem Leib das Herz herausoperieren“, so del Toro im Podcast The Director’s Cut (2016). Er spricht später von einem „emotionalen Trauma“, das ihn lehrte, dass kreative Kontrolle kein Luxus ist, sondern Überleben. In einem Interview sagt er rückblickend: „Ich war naiv. Ich dachte, Talent reicht. Aber in Hollywood brauchst du Rückgrat aus Stahl und ein Herz aus Gummi.“
Der Film floppt, zumindest aus seiner Sicht, obwohl Kritiker heute den Directors Cut als unterschätzten Versuch werten, den Industrial-Horror mit barocker Ästhetik zu verbinden. Für del Toro bleibt Mimic eine klaffende Wunde und der Ausgangspunkt für seine radikale Identitätsfindung als Autor und Regisseur. „Nach Mimic wusste ich, dass ich nie wieder etwas drehen werde, das mir nicht gehört“, schrieb er 2013 in seinem Cabinet of Curiosities. Er kehrt nach Spanien zurück, erschöpft, aber fest entschlossen. Was als Rückzug beginnt, wird zur glorreichen Wiedergeburt.
Der Alchemist und seine Werkstatt
Wer del Toros Haus in Los Angeles betritt, betritt kein Wohnhaus, sondern ein Museum. Zwischen viktorianischen Puppen, anatomischen Modellen und Reliquien steht eine Nachbildung von Karloffs Monster, beleuchtet von Kirchenfenstern. „Bleak House“ nennt er diesen Ort, halb Bibliothek, halb Labor. „Hier spreche ich mit meinen Geistern“, sagte er gegenüber Vanity Fair . Dieses private Kuriositätenkabinett ist die physische Manifestation seiner Philosophie: Das Monströse ist kein Störfaktor, sondern ein Bestandteil des Schönen.
In seiner Ästhetik wird das Hässliche zum Ornament, das Fremde zum Heiligen. Schon Cronos zeigt diese Symbiose. Del Toro nennt sie „katholische Barockromantik“, ein Begriff, der seine Filme besser beschreibt als jedes Genrelabel. Wo amerikanischer Horror oft auf Schockeffekte setzt, sucht del Toro nach Transzendenz. Er will, dass das Publikum fühlt, bevor es erschrickt. Der Theologe und Filmwissenschaftler Christopher Campling formulierte es in Sight & Sound (2020) so: „Del Toros Kino ist ein Akt der Empathie. Seine Monster sind Bekenntnisse, keine Bedrohungen.“
In Interviews wiederholt del Toro eine seiner zentralen Thesen: „Ich mache keine Horrorfilme. Ich mache Liebesfilme, nur mit Monstern.“ Für ihn ist das Ungeheuer der ehrlichste Ausdruck menschlicher Emotion. In jedem deformierten Körper sieht er ein psychisches Porträt. Diese Sichtweise wurzelt tief in der mexikanischen Kultur, in der der Tod kein Ende, sondern ein ständiger Begleiter ist. Der Día de los Muertos wird gefeiert, nicht gefürchtet. Auch del Toros Filme feiern das Morbide, nicht als Nihilismus, sondern als Beweis dafür, dass Leben und Verfall untrennbar verbunden sind.
In Cronos verwandelt sich das Streben nach ewigem Leben in eine Metapher für menschliche Hybris. In Mimic spiegeln die mutierten Insekten die Angst vor genetischer Selbstüberschätzung. In beiden Fällen ist das „Monster“ die Konsequenz menschlicher Gier und zugleich das Opfer. „Ich habe nie Angst vor Monstern“, sagte del Toro bei den BAFTAs 2018. „Ich habe Angst vor Menschen, die keine (Menschen) sind.“

Eine Theologie aus Licht und Staub
Visuell erschafft del Toro eine Welt, die zugleich sakral und verfallen ist. Er nutzt Licht wie Weihrauch, um Räume zu reinigen oder zu vernebeln. Gold und Rost, Rot und Ocker dominieren seine Palette. Jedes Bild scheint von einem Heiligenschein aus Fäulnis umgeben. Kameramann Guillermo Navarro erklärte im Gespräch mit American Cinematographer (2007): „Guillermo sieht Farbe als Emotion, nicht als Dekoration. Wenn er Gold verwendet, dann, weil Gold für ihn das Licht der Vergebung ist.“ Diese „ästhetische Theologie“ macht Cronos zu einem Frühwerk von erstaunlicher Reife. Del Toro verwebt barocke Formen mit moderner Mythologie, ein Kino, das fühlt, bevor es denkt.
Am Ende der 1990er Jahre steht Guillermo del Toro an einem Scheideweg. Hollywood hat ihn fast verschluckt, doch seine Vision hat überlebt. Er ist 33, ausgepowert, aber klar und reflektiert. Er formuliert es schlicht: „Ich habe gelernt, dass das Monster ich bin. Und das ist in Ordnung.“ Dieses Bekenntnis markiert den Wendepunkt. Aus dem talentierten Regisseur wird ein Autor mit unverwechselbarer Stimme. Seine nächsten Filme, The Devil’s Backbone (2001) und Pan’s Labyrinth (2006), werden zu Meditationen über Erinnerung, Verlust und die Möglichkeit von Gnade.
Doch alles, was folgt, wurzelt in dieser Anfangszeit. In dem Jungen, der Boris Karloff ansah und Mitgefühl statt Angst empfand. In dem Künstler, der im Gold des Verfalls Schönheit sah. In dem Alchemisten, der aus Blut und Staub Poesie machte. Cronos und Mimic sind mehr als frühe Werke, sie sind die Geburtskammern einer Vision. Sie lehren del Toro, dass Kontrolle über das eigene Schaffen keine Eitelkeit ist, sondern ein moralischer Imperativ.
Sie zeigen, dass Horror eine Form der Liebe sein kann und das Monster ein Bekenntnis zur Menschlichkeit. Guillermo del Toro ist in dieser Phase kein Regisseur des Schreckens, sondern ein Architekt des Mitgefühls. Zwischen Schöpfung und Verdammnis formt er eine Kunst, die den Glauben an das Gute im Dunkeln sucht und darin, paradoxerweise, Erlösung findet.
JETZT LESEN : DAS HERZ DER FINSTERNIS Teil 2