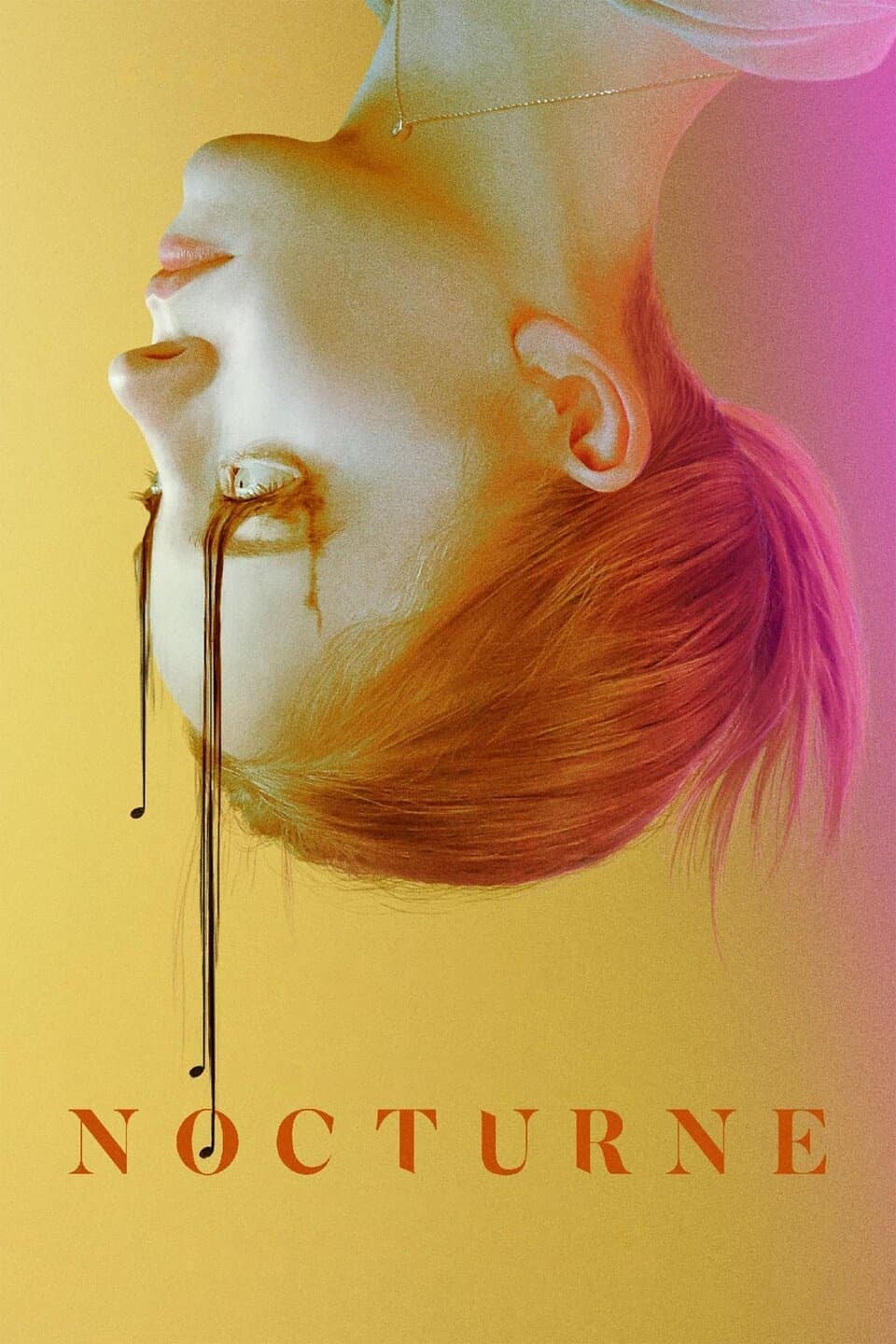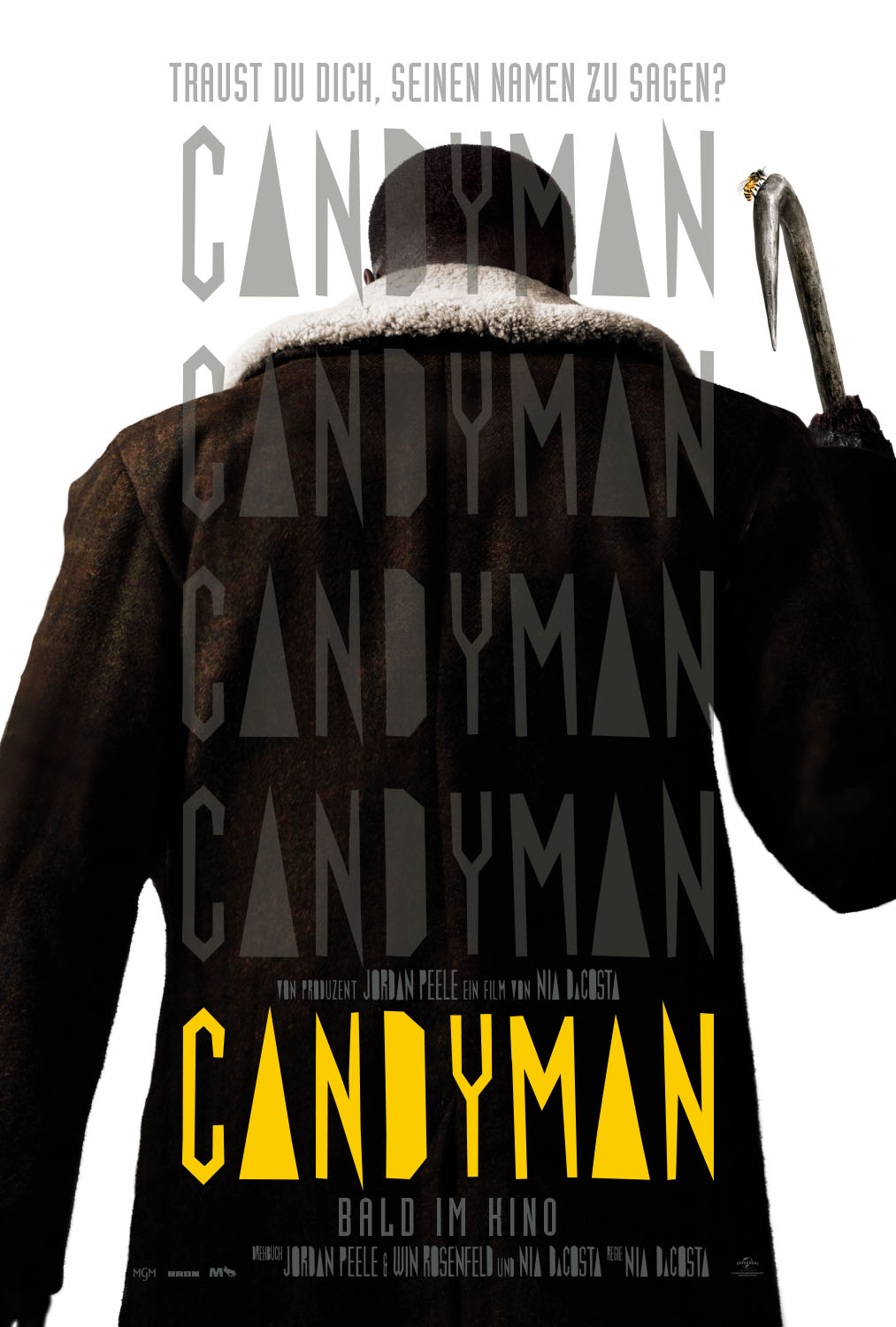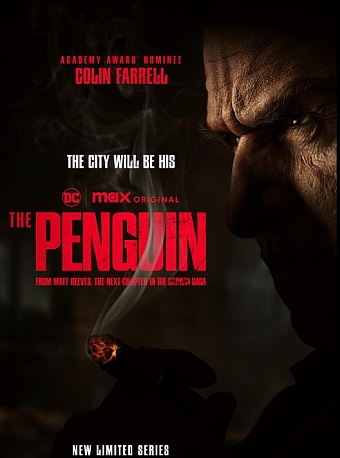Inhalt: Elliot Kintner (Paul Rudd) und seine Teenagertochter Ridley (Jenna Ortega) sind auf dem Weg zum abgelegenen Anwesen von Elliots exzentrischem, schwerreichen Chef Odell Leopold (Richard E. Grant), als sie versehentlich ein Einhorn überfahren … und töten. Sie ahnen nicht, welche unerwarteten magischen Kräfte dieses besitzt und welche verhängnisvollen Ereignisse sie damit in Gang setzen. Denn Odell Leopold hat eine eigene Agenda, was die Ausbeutung der Heilkräfte des Einhorns angeht.
Ein Start mit Knall – und dann direkt Vollbremsung
Die Anfangstitel kommen genau zum richtigen Zeitpunkt. Ein gehörntes, mythisches Pferd wird von einem Auto überfahren – zack, „Death Of A Unicorn“ flackert auf der Leinwand. Ein schräger, vielversprechender Moment. Wer hier auf eine wilde B-Movie-Fahrt gehofft hat, wird leider enttäuscht: Statt schräger Einhorn-Action gibt es Genre-Schwurbel, große Themen und jede Menge Leerlauf. In der Post-Get Out-Ära will eben jeder Horrorfilm irgendwie „bedeutsam“ sein – so auch dieser. Aber weder die Gesellschaftskritik noch der Trash-Faktor funktionieren hier richtig.
Paul Rudd gibt den Anwalt Elliot Kintner im peinlichen Vatermodus, manchmal sogar im peinlich-berührten Vatermodus. Netter Kerl? Nicht hier. Trotz Rudds Bemühungen ist Elliot zu unsympathisch, um auch nur annähernd ein überzeugender Protagonist zu sein. Er stellt seine Karriere regelmäßig über seine Familie und handelt – trotz einer Kehrtwende in letzter Minute – ausschließlich in seinem eigenen Interesse.
Jenna Ortega bringt ein bewährtes Maß an losgelöstem Grufti-Charisma und ihren typischen „Ich hasse alles und jeden“-Charme. Aber ihre Ridley ist scheint ein KI-generierter Gen-Z-Archetyp zu sein, der Sätze wie „Philanthropie ist Imagepflege für die Oligarchie!“ sagt und schließlich zur Standard-Heldin wird: Ortega kämpft tapfer, aber sie kann auch nur so viel aus einem dünn geschriebenen Charakter herausholen, bevor selbst sie sich zu langweilen scheint.
Satire auf den Spätkapitalismus? Leider verfehlt
Die einprägsamsten Charaktere sind die Leopolds, die die plötzliche Ankunft einer Einhorn Leiche auf ihrem luxuriösen Anwesen in den Bergen als höchst vermarktbare Chance sehen. Will Poulter als Donald Trump Jr.-ähnlicher Thronfolger genießt einige der besten Momente des Films. Richard E. Grant als abgehobener Milliardär Odell Leopold? Schreit seine Boshaftigkeit so plakativ heraus, dass es selbst in einer Telenovela peinlich wäre. Téa Leoni als glamouröse Ehefrau Belinda darf Deko sein.
Regisseur und Drehbuchautor Alex Scharfman möchte offensichtlich etwas zum Thema Gier und moralischer Verfall sagen. Das Problem: Hier wird alles auf eine reichlich abgegriffene Formel reduziert: Reiche Menschen sind böse. Ok. Haben wir verstanden. Nach zehn Minuten. Aber eine echte Satire braucht die feine Klinge – hier wird mit dem Holzhammer auf den Zuschauer eingeprügelt.
Auch die verrückteren B-Movie-Einwürfe sind nicht gelungen. Und der Trash-Spaß? Kratzt am Mittelmaß. Blutrünstige Einhörner mit leuchtenden Hörnern, die Menschen jagen – das klingt nach Trash-Gold. Stattdessen bekommen wir CGI-Gore, welches an PlayStation-2-Zwischensequenzen erinnert, und schwerelos animierte Wesen, die aussehen wie Minecraft-NPCs auf Acid. Weder Grusel noch echte Eskalation kommt auf. Blutig ja, aber alles bleibt seltsam spannungsarm.
Fazit: Was hätte Death Of A Unicorn sein können? Eine irrwitzige B-Movie-Perle oder eine richtig scharfe Kapitalismus-Abrechnung. Was bekommen wir? Weder noch. Nicht einmal Paul Rudd oder Jenna Ortega können den Film retten. The White Lotus hatte Biss. Triangle of Sadness hatte Mut. Death Of A Unicorn hat – ein totes Einhorn. Und nicht viel mehr. Film Bewertung 4 / 10